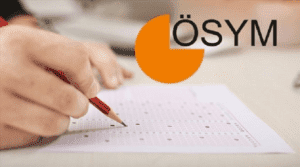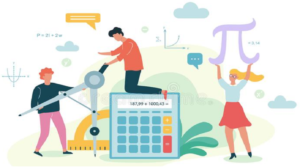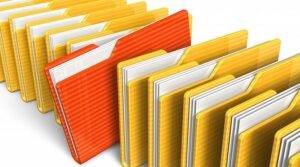Loading…
Loading…
Ar|ti|ku|la|ti|on , [Talep,Çağrı,Emir] die; -, -en [spätlat. articulatioÿ=ÿgegliederter
Vortrag]:
- a) deutliche Aussprache, Gliederung des Gesprochenen;
b) (Sprachw.) Bildung von Lauten mithilfe der Sprechwerkzeuge. - das Artikulieren (2): die A. der Gedanken.
- (Musik) Binden od. Trennen der Töne
Au}f|for|de|rung , [Çağrı,Talep] die; -, -en:
a) mit Nachdruck vorgebrachte Bitte: eine freundliche, energische, versteckte A.; wir
können Ihrer A. zu sofortiger Zahlung leider nicht nachkommen; auf wiederholte A.
[hin] öffnete er;
b) Einladung: eine A. zu einem Besuch;
*A. zum Tanz (ugs.; Herausforderung).
Be|deu|tungs|wan|del , [Anlam Değişimi] der (Sprachw.): Veränderung der
Wortbedeutung.
Code , [Kod] Kode [ko:t], der; -s, -s [engl. code, frz. code < lat. codex, Kodex]:
- (Informationst.) System von Regeln u. Übereinkünften, das die Zuordnung von
Zeichen, auch Zeichenfolgen zweier verschiedener Zeichenvorräte erlaubt;
Schlüssel, mit dessen Hilfe ein chiffrierter Text in Klartext übertragen werden kann. - (Sprachw.) vereinbartes Inventar sprachlicher Zeichen u. Regeln zu ihrer
Verknüpfung. - (Soziolinguistik) durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht
vorgegebene Weise der Verwendung von Sprache: elaborierter C. (Sprechweise der
Ober- u. Mittelschicht); restringierter C. (Sprechweise der Unterschicht).
De|no|tat , [Temel Anlam] das; -s, -e zu lat. denotatum, 2.ÿPart. von: denotare = bezeichnen:
- vom Sprecher bezeichneter Gegenstand od. Sachverhalt in der
außersprachlichen Wirklichkeit. - begrifflicher Inhalt eines sprachlichen Zeichens im Gegensatz zu den emotionalen
Nebenbedeutungen.
de|no|ta|tiv , [Temel Anlamsal] [auch: ‘de:…] <Adj.> (Sprachw.): nur den
begrifflichen Inhalt eines sprachlichen Zeichens betreffend, ohne Berücksichtigung
von Nebenbedeutungen.
Di|a|log , [Diyolag] der; -[e]s, -e [frz. dialogue < lat. dialogus < griech. diálogos,
eigtl.ÿ= Gespräch, zu: dialégesthai, Dialekt]:
- (bildungsspr.)
a) von zwei od. mehreren Personen abwechselnd geführte Rede u. Gegenrede;
Zwiegespräch, Wechselrede: zwischen ihnen entspann sich ein D.; einen D. mit
jmdm. führen; ein Stück mit geschliffenen -en;
b) Gespräche, die zwischen zwei Interessengruppen geführt werden mit dem Zweck
des Kennenlernens der gegenseitigen Standpunkte o.ÿÄ.: ein D. zwischen den
Vertretern beider Staaten; die Fortsetzung des -s mit Moskau. - (Film, Ferns.) Gesamtheit der Dialoge (1 a) in einem Drehbuch.
- (EDV) wechselseitige Kommunikation, Austausch von Fragen u. Antworten
zwischen Mensch u. Datenverarbeitungsanlage über Tastatur u. Terminal.
dop|pel|deu|tig , [İki Anlamlılık] <Adj.>[
a) auf doppelte Weise deutbar: ein -es Wort;
b) bewusst auf zweideutige, einen anzüglichen o.ÿä. Nebensinn enthaltende Weise
formuliert: einen -en Witz erzählen.
dy|na|misch , [Dinamik] <Adj.> [zu griech. dynamikósÿ= mächtig, wirksam]:
- (Physik) die von Kräften erzeugte Bewegung betreffend: -e Gesetze.
- a) eine Bewegung, Entwicklung aufweisend: eine -e Sozialpolitik; -e Kräfte treiben
die Ereignisse voran; -e Rente (Rente, deren Höhe nicht auf Lebenszeit festgesetzt,
sondern periodisch der Entwicklung des Sozialprodukts angepasst wird);
b) durch Schwung u. Energie gekennzeichnet; Tatkraft u. Unternehmungsgeist
besitzend: ein -er Typ; wir suchen eine -e Persönlichkeit. - (Musik) die Differenzierung der Tonstärken betreffend: -e
[Vortrags]bezeichnungen; der Künstler zeigte ein d. ausgefeiltes Spiel.
Emp|fän|ger , [Alıcı,Gönderilen] der; -s, -:
- jmd., der etw. empfängt, entgegennimmt, dem etw. zuteilwird.
- (Funkw., Rundf., Ferns.) Empfangsgerät
Ety|mo|lo|gie , [Köken Bilim] die; -, -n lat. etymologia < griech. etymología, eigtl.ÿ= Untersuchung des wahren (ursprünglichen) Sinnes eines Wortes, zu: étymon (Etymon) u. lógos, Logos:
- <o.ÿPl.> Wissenschaft von der Herkunft u. Geschichte der Wörter u. ihrer
Bedeutungen. - Herkunft u. Geschichte eines Wortes u. seiner Bedeutung: die E. eines Wortes
angeben.
Fä|hig|keit , [Yetenek] die; -, -en:
- <meist Pl.> geistige, praktische Anlage (6), die zu etwas befähigt, Wissen,
Können, Tüchtigkeit: jmds. geistige -en; -en in jmdm. wecken; seine -en für etw.
einsetzen; an jmds., den eigenen -en zweifeln. - <o.ÿPl.> das Imstandesein, In-der-Lage-Sein, das Befähigtsein zu etw.,
Vermögen, etw. zu tun: die F., jmdn. zu überzeugen, geht ihm ab.
3.*den K. voll haben (salopp: 1. betrunken sein. 2. einer Sache gründlich
überdrüssig sein). - (Rundf., Ferns.) bestimmter Frequenzbereich eines Senders: einen K. wählen,
einschalten; eine Sendung auf einem K. sehen; was läuft im andern K.? - Weg, auf dem etw. (bes. Informationen) weitergeleitet wird: diplomatische, dunkle,
geheime Kanäle.
Far|be , [Renk] die; -, -n [mhd. varwe, ahd. farawa, zu mhd. var, varwer, ahd. faro,
farawer = farbig, urspr. = gesprenkelt, bunt]:
- a) mit dem Auge wahrnehmbare Erscheinungsweise der Dinge, die auf der
verschiedenartigen Reflexion und Absorption von Licht beruht: eine dunkle, helle,
warme, kalte, giftige F.; grelle, schreiende, leuchtende -n; die -n sind gut aufeinander
abgestimmt; diese -n beißen sich; in allen -n schillern; drei Hefte in den -n Gelb, Rot
u. Orange; sein Gesicht verlor plötzlich alle F. (wurde blass, bleich); du hast wieder
richtig F. bekommen (du siehst gesund aus); Ü ihr Spiel bekam, gewann immer mehr
F. (Ausdruckskraft, Lebendigkeit);
*die F. wechseln (blass u. wieder rot werden);
b) <o.ÿPl.> das Buntsein, Farbigsein (1): die meisten Abbildungen des Buches sind
in F. (farbig, bunt);
c) Farbton: ein in zarten -n gehaltenes Bild.
- färbende Substanz; Mittel zum Färben, Anmalen; Farbstoff: eine schnell
trocknende, gut deckende F.; die F. blättert von der Wand; die -n laufen ineinander;
die F. dick auftragen; du kannst ruhig noch etwas F. (Make-up) auflegen; es roch
nach frischer F.; Ü etw. in den schwärzesten -n malen, schildern, beschreiben
(außerordentlich negativ, pessimistisch darstellen). - Farbe (1 a) als Symbol eines Landes, einer Vereinigung o.ÿÄ.: er vertritt bei den
Wettkämpfen die -n seines Landes, seines Vereins; Fähnchen in den französischen –
n; ein -n tragender (einer [schlagenden] Verbindung, einem Korps angehörender)
Student;
*die F. wechseln (seine [politische] Überzeugung ändern, zu einer anderen Partei,
Vereinigung o.ÿÄ. übergehen). - durch die gleichen Zeichen gekennzeichnete Serie von Spielkarten eines
Kartenspiels: eine F. ausspielen, bekennen;
*F. bekennen (ugs.; seine [wirkliche] Meinung zu etw. nicht länger zurückhalten).
Kom|mu|ni|ka|ti|on , [İletişim] die; – [lat. communicatioÿ= Mitteilung, Unterredung]:
Verständigung untereinander; zwischenmenschlicher Verkehr bes. mithilfe von
Sprache, Zeichen: sprachliche, nonverbale K.; K. durch Sprache; die K. stören,
verbessern.
Kör|per|kon|takt , [Beden Dili] der: körperlicher Kontakt: das Baby braucht viel K.
zur Mutter.
Kul|tur , [Kültür] die; -, -en [lat. culturaÿ= Landbau; Pflege (des Körpers u. Geistes),
zu: cultum, Kult]:
- a) <o.ÿPl.> Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen
einer Gemeinschaft als Ausdruck menschlicher Höherentwicklung: die menschliche
K.; die Abteilung für K. (Kunst u. Wissenschaft); ein durch Sprache und K.
verbundenes Volk; führende Kräfte im Bereich von Politik und K.; von der K.
[un]beleckt sein (ugs.; [un]zivilisiert, kulturell [nicht] entwickelt sein);
b) Gesamtheit der von einer bestimmten Gemeinschaft auf einem bestimmten
Gebiet während einer bestimmten Epoche geschaffenen, charakteristischen
geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen: die abendländische K.; primitive,
frühe, verschollene, versunkene -en; die K. der Griechen, der Renaissance in Italien;
ein Land mit alter K.
- <o.ÿPl.>
a) Verfeinerung, Kultiviertheit einer menschlichen Betätigung, Äußerung,
Hervorbringung: seine Stimme hat K. (klingt [aufgrund sorgfältiger Ausbildung]
ausgewogen); sie machen in K. (ugs.; legen feine Manieren an den Tag);
b) Kultiviertheit einer Person: sie besitzen [keine] K.; er ist ein Mensch ohne jede K. - <o.ÿPl.> (Landw., Gartenbau)
a) das Kultivieren (1) des Bodens: die K. des Bodens verbessern; ein Stück Land in
K. nehmen (kultivieren);
b) das Kultivieren (2): die K. von Erdbeeren, Rosen betreiben; das Klima lässt hier
die K. von Mais nicht zu. - (Landw., Gartenbau, Forstw.) auf größeren Flächen kultivierte junge Pflanzen: die
-en stehen gut; -en von Rosen, Buchen. - (Biol., Med.) auf geeigneten Nährböden in besonderen Gefäßen gezüchtete
Mikroorganismen od. Gewebszellen: bakteriologische -en; eine K. Anlegen
1 laut , [Sesli] <Adj.> [mhd. lut, ahd. (h)lut, urspr.ÿ= gehört u. Partizipialbildung zu
einem Verb mit der Bed. »hören«]:
a) weithin hörbar, mit kräftigem Klang: -e Worte; -e Musik; -es Rufen, Getrampel; -er
Jubel, Beifall; der Motor, das Radio ist zu l.; die Maschine läuft l.; lass das Radio
nicht so l. laufen!; du musst -er sprechen; muss ich erst l. werden (schimpfen;
drohend die Stimme erheben)?; l. lesen, lachen, schreien; l. und deutlich seine
Meinung sagen; ein -es Wesen haben (unbekümmert laut sprechen u. wenig
Feingefühl haben); er hat l. gedacht (vor sich hin geredet, zu sich selbst gesprochen);
sie denken l. darüber nach (diskutieren, erörtern), ob sie sich trennen sollen; das
darfst du nicht l. sagen, aussprechen (das solltest du besser für dich behalten); Ü -e
(grelle) Farben; -e (aufdringliche) Reklame;
b) geräuschvoll, lärmerfüllt: eine -e Gegend, Straße; -e (häufig Lärm verursachende)
Nachbarn; hier ist es mir zu l., geht es immer l. zu; seid doch nicht so l.!
Li|ne|a|ri|tät , [Çizgisellik,Doğrusallık] die; – zu linear: lineare
Beschaffenheit.
Lin|gu|is|tik , [Dil Bilim] die; – [als Bez. für die moderne Sprachw. (frz. linguistique)
eingef. von dem Schweizer Sprachwissenschaftler F.ÿde Saussure (1857þ1913)]:
Sprachwissenschaft, bes. der modernen (systembezogenen) Prägung.
Li|te|ra|tur|wis|sen|schaft , [Edebiyat,Yazın Bilimi] die <Pl. selten>: Wissenschaft,
die sich mit der Literatur im Hinblick auf Geschichte, Formen, Stilistik u.ÿa. befasst.
Mit|tei|lung , [Bildiri] die; -, -en: etw., was jmdm. mitgeteilt (1) wird, wovon jmdm.
Kenntnis gegeben wird: eine briefliche, vertrauliche, amtliche M.; jmdm. eine M.
[über, von etw.] machen (etw. förmlich mitteilen); nach M. der Behörden.
Mo|dell , [Model] das; -s, -e [ital. modelloÿ= Muster, Entwurf, zu lat. modulus,
1 Modul]:
- a) Form, Beschaffenheit, Maßverhältnisse veranschaulichende Ausführung eines
vorhandenen od. noch zu schaffenden Gegenstandes in bestimmtem (bes.
verkleinerndem) Maßstab: das M. eines Schiffes, Flugzeugs, einer Burg, Fabrik; ein
M. entwerfen, bauen;
b) (Technik, bild. Kunst) Muster, Entwurf einer Plastik, eines technischen o.ÿä.,
durch Guss herzustellenden Gegenstandes, nach dem die Guss- bzw. Gipsform
hergestellt wird: das M. einer Plastik;
c) (Wissensch.) innere Beziehungen u. Funktionen von etw. abbildendes bzw.
[schematisch] veranschaulichendes [u. vereinfachendes, idealisierendes] Objekt,
Gebilde: ein M. des Atomkerns;
d) (math. Logik) Interpretation eines Axiomensystems, nach der alle Axiome des
Systems wahre Aussagen sind. - a) als Gegenstand der bildnerischen, künstlerischen o.ÿä. Darstellung od.
Gestaltung benutztes Objekt, Lebewesen usw.;
b) Person, die sich [berufsmäßig] als Gegenstand bildnerischer od. fotografischer
Darstellung, Gestaltung zur Verfügung stellt: als M. arbeiten;
*[jmdm.] M. sitzen/stehen (jmds. Modell sein): sie hat dem Maler für dieses Bild M.
gesessen;
c) 2 Model (a);
d) (verhüll.) Hostess (3). - a) (Gegenstand als) Entwurf, Muster, Vorlage für die (serienweise) Herstellung
von etw.;
b) Typ, Art der Ausführung eines Fabrikats;
c) (Rechtsspr.) durch Gesetz urheberrechtlich geschützte Gestaltungsform eines
Gebrauchsgegenstandes. - (Mode) [Kleidungs]stück, das eine Einzelanfertigung ist [u. ungefähr als Muster,
Vorlage od. Anhaltspunkt für die serienweise Herstellung bzw. Konfektion dienen
kann]: ein Pariser M. - (bildungsspr.)
a) etw., was (durch den Grad seiner Perfektion, Vorbildlichkeit o.ÿÄ.) für anderes od.
für andere Vorbild, Beispiel, Muster sein kann: etw. nach dem M. von etw. gestalten;
b) als Muster gedachter Entwurf: das M. eines neuen Gesetzes.
Mor|phem , [Biçim Bilim] das; -s, -e [frz. morphème, zu griech. morphe, Morphe]
(Sprachw.): kleinste bedeutungstragende Einheit im Sprachsystem; Sprachsilbe: freie
u. gebundene -e.
Mor|pho|lo|gie , [Biçim Bilgisi] die; – [-logie]:
- (bes. Philos.) Wissenschaft, Lehre von den Gestalten, Formen (bes. hinsichtlich
ihrer Eigenarten, Entwicklungen, Gesetzlichkeiten). - (Biol., Med.) Wissenschaft, Lehre von der äußeren Gestalt, Form der Lebewesen,
der Organismen u. ihrer Teile. - kurz für Geomorphologie.
- (Sprachw.) Formenlehre (1).
Na|tur|wis|sen|schaft , [Doğa Bilimi] die <meist Pl.>:
a) Gesamtheit der exakten Wissenschaften
, die die verschiedenen Gebiete der Natur (1) zum Gegenstand haben;
b) einzelne Wissenschaft, die ein bestimmtes Gebiet der Natur (1) zum Gegenstand
hat.
- (Soziol.) Teilgebiet der Soziologie, das sich mit der Struktur der Gesellschaft
befasst
Netz|werk , [Şebeke] das:
- netzartig verbundene Leitungen, Drähte, Linien, Adern o.ÿÄ.: Ü ein N. von
Beziehungen. - (Elektrot.) Zusammenschaltung einer beliebigen Anzahl Energie liefernder u.
Energie speichernder od. umwandelnder Bauteile od. Schaltelemente, die
mindestens zwei äußere Anschlussklemmen aufweist. - (Wirtsch.) Netzplan.
- (im New Age) Netz (2 d) autonomer, durch gemeinsame Werte od. Interessen
verbundener Teilnehmer. - (EDV) Network (2).
Pho|nem , [Ses Birim] Fonem, das; -s, -e (Sprachw.): kleinste
bedeutungsunterscheidende sprachliche Einheit (z.ÿB. b in »Bein« im Unterschied zu
p in »Pein«).
Pho|ne|tik , [Ses Bilgisi] Fonetik, die; -: Wissenschaft von den sprachlichen Lauten
(2), ihrer Art, Erzeug u. Verwendung in der Kommunikation
Psy|cho|lin|gu|is|tik , [Ruhbilim] die; – (Sprachw.): Wissenschaft von den
psychischen Vorgängen beim Erlernen der Sprache u. bei ihrem Gebrauch.
Sprach|sys|tem , [Dil,Konuşma Sistemi] das (Sprachw.): System aus den in
gleicher Weise immer wieder vorkommenden, sich wiederholenden sprachlichen
Elementen u. Relationen, das dem Angehörigen einer bestimmten
Sprachgemeinschaft zur Verfügung steht.
Sen|der , [Gönderici] der; -s, – [2: spätmhd. sender]:
- a) Anlage, die Signale, Informationen u.ÿa. in elektromagnetische Wellen
umwandelt u. in dieser Form abstrahlt: ein [leistungs]starker, schwacher S.; ein
anderer S. schlägt durch;
b) Rundfunk-, Fernsehsender: ein privater, öffentlich-rechtlicher, illegaler S.; die
angeschlossenen S. kommen mit eigenem Programm wieder; einen S. gut, schlecht
empfangen können; einen anderen S. einstellen, suchen; ausländische S. hören; den
S. kriege ich schlecht, nicht rein; auf dem S. sein/über den S. gehen (Jargon;
gesendet werden); das Programm wurde von vielen in- und ausländischen -n
übernommen;
c) Funkhaus: jmdn. im S. anrufen.
Se|man|tik , [Anlam Bilim] die; – zu griech. semantikósÿ= bezeichnend, zu: semaíneinÿ= bezeichnen, zu: sema, Sem:
- Teilgebiet der Linguistik, das sich mit den Bedeutungen sprachlicher Zeichen u.
Zeichenfolgen befasst. - Bedeutung, Inhalt (eines Wortes, Satzes od. Textes).
. (selten) jmd., der jmdn., etw. irgendwohin schickt
Se|mi|o|tik , [Gösterge Bilimi] die; – [zu griech. semeiotikósÿ= zum (Be)zeichnen
gehörend]:
- (Philos., Sprachw.) Semiologie (1).
- (Med.) Symptomatologie.
schutz|be|dürf|tig , [Koruyucu] <Adj.>: Schutz nötig habend: -e Personengruppen.
Si|gnal , [Signal] [auch: ºê–’®¡:¬], das; -s, -e [frz. signal < spätlat. signale, subst.
Neutr. von lat. signalisÿ= dazu bestimmt, ein Zeichen zu geben, zu: signum, Signum]:
- [optisches od. akustisches] Zeichen mit einer bestimmten Bedeutung: optische,
akustische -e; das S. zum Angriff; das S. bedeutet Gefahr, freie Fahrt; ein S. geben,
blasen, funken; Ü ein hoffnungsvolles S. (Anzeichen);
*-e setzen (bildungsspr.; etw. tun, was richtungweisend ist; Anstöße geben): seine
Erfindung hat, mit seiner Erfindung hat er -e gesetzt. - a) (Eisenb.) für den Schienenverkehr an der Strecke aufgestelltes Schild o.ÿÄ. mit
einer bestimmten Bedeutung bzw. [fernbediente] Vorrichtung mit einer beweglichen
Scheibe, einem beweglichen Arm o.ÿÄ., deren Stellung, oft in Verbindung mit einem
Lichtsignal, eine bestimmte Bedeutung hat: das S. steht auf »Halt«; der Zugführer
hatte ein S. übersehen; Ü für die Wirtschaft stehen alle -e auf Investition (die
wirtschaftliche Lage lässt Investitionen angezeigt erscheinen);
b) (bes. schweiz.) Verkehrszeichen für den Straßenverkehr.
- (Physik, Kybernetik) Träger einer Information (z.ÿB. eine elektromagnetische
Welle), der entsprechend dem Inhalt der zu übermittelnden Information moduliert (3)
wird: analoge, digitale -e.
Si|gnal|far|be , [İşaret Rengi] die: große Leuchtkraft besitzende u. daher stark
auffallende Farbe.
si|gni|fi|kant , [Sözlü İfade] <Adj.> [lat. significans (Gen.: significantis)ÿ=
bezeichnend; anschaulich, adj. 1. Part. von: significare, signifizieren]:
a) (bildungsspr.) in deutlicher Weise als wesentlich, wichtig, erheblich erkennbar: ein
-er Unterschied; das wohl -este politische Ereignis des Jahres;
b) (Statistik) zu groß, um noch als zufällig gelten zu können: ein -er Anstieg der
Leukämierate;
c) (bildungsspr.) in deutlicher Weise als kennzeichnend, bezeichnend,
charakteristisch, typisch erkennbar: -e Merkmale.
So|zio|lin|gu|is|tik , [Toplum Bilim] die; -: Teilgebiet der Sprachwissenschaft, das
das Sprachverhalten sozialer Gruppen untersucht.
sta|tisch , [Statik] [auch: ‘st…] <Adj.> [zu Statik]:
- (Physik) das von Kräften erzeugte Gleichgewicht betreffend: -e Gesetze.
- (Bauw.) die Statik (2) betreffend: -e Berechnungen.
- (bildungsspr.) keine Bewegung, Entwicklung aufweisend: eine -e
Gesellschaftsordnung.
Struk|tu|ra|lis|mus , [Yapısalcılık] der; – [frz. structuralisme]:
- (Sprachw.) wissenschaftliche Richtung, die Sprache als ein geschlossenes
Zeichensystem versteht u. die Struktur dieses Systems erfassen will. - Forschungsmethode in der Völkerkunde, die eine Beziehung zwischen der
Struktur der Sprache u. der Kultur einer Gesellschaft herstellt u. die alle jetzt
sichtbaren Strukturen auf geschichtslose Grundstrukturen zurückführt. - Wissenschaftstheorie, die von einer synchronen Betrachtungsweise ausgeht u.
die allem zugrunde liegenden, unwandelbaren Grundstrukturen erforschen will.
Stö|rung , [Hışırtı] die; -, -en [mhd. ³´Ä²µ®§¥]:
- das Stören (1); das Gestörtwerden (1): eine kurze, kleine, nächtliche S.; häufige
Störungen bei der Arbeit; bitte entschuldigen Sie die S.! - a) das Stören (2); das Gestörtwerden (2): eine S. des Gleichgewichts; die S. von
Ruhe und Ordnung; die Sache verlief ohne S.;
b) das Gestörtsein (2) u. dadurch beeinträchtigte Funktionstüchtigkeit:
gesundheitliche, nervöse -en; eine technische S. beheben, beseitigen; die Sendung
fiel infolge einer S. aus;
c) (Met.) [wanderndes] Tiefdruckgebiet: atmosphärische Störungen; die -en greifen
auf Osteuropa über.
Sub|sys|tem , [Alt Sistem] das; -s, -e [zu lat. subÿ= unter u. System] (Fachspr., bes.
Sprachw., Soziol.): Bereich innerhalb eines Systems, der selbst Merkmale eines
Systems aufweist.
Symp|tom , [Belirti] das; -s, -e [spätlat. symptoma < griech. sımptoma (Gen.:
symptomatos)ÿ= vorübergehende Eigentümlichkeit, zufallsbedingter Umstand, zu:
sympípteinÿ= zusammenfallen, -treffen, sich zufällig ereignen, zu: sınÿ= zusammen
u. pípteinÿ= fallen]:
a) (Med.) Anzeichen einer Krankheit; für eine bestimmte Krankheit charakteristische
Erscheinung: klinische Symptome; ein S. für Gelbsucht; die -e von Diphtherie;
b) (bildungsspr.) Anzeichen einer [negativen] Entwicklung; Kennzeichen: die -e
dieser Entwicklung sind Gier und Egoismus.
syn|chro|ni|sie|ren , [Senkronize etmek] ,<sw. V.; hat> [vgl. engl. synchronize, frz.
synchroniser]:
- (bes. Film)
a) Bild u. Ton in zeitliche Übereinstimmung bringen;
b) zu den Bildern eines fremdsprachigen Films, Fernsehspiels die entsprechenden
Worte der eigenen Sprache sprechen, die so aufgenommen werden, dass die
Lippenbewegungen der Schauspieler (im Film) in etwa mit den gesprochenen Worten
übereinstimmen: einen Film s.; die synchronisierte Fassung eines Films.
- (Technik) den Gleichlauf zwischen zwei Vorgängen, Maschinen od. Geräte[teile]n
herstellen. - zeitlich aufeinander abstimmen: die Arbeit von zwei Teams s.
Syn|chro|nie , [Senkronie], die; – [frz. synchronie, zu: synchroneÿ= synchron]
(Sprachw.):
a) Zustand einer Sprache in einem bestimmten Zeitraum (im Gegensatz zu ihrer
geschichtlichen Entwicklung);
b) Beschreibung sprachlicher Phänomene, eines sprachlichen Zustandes innerhalb
eines bestimmten Zeitraums.
Syn|tax , [Cümle Bilgisi], die; -, -en lat. syntaxis < griech. sıntaxis, eigtl.ÿ= Zusammenstellung, aus: sınÿ= zusammen u. táxisÿ= Ordnung:
a) in einer Sprache übliche Verbindung von Wörtern zu Wortgruppen u. Sätzen;
korrekte Verknüpfung sprachlicher Einheiten im Satz: die S. (syntaktische
Verwendung) einer Partikel;
b) Lehre vom Bau des Satzes als Teilgebiet der Grammatik; Satzlehre;
c) wissenschaftliche Darstellung der Syntax (b).
Sys|tem , [Sistem] das; -s, -e [spätlat. systema < griech. sıstemaÿÿ= aus mehreren
Teilen zusammengesetztes u. gegliedertes Ganzes, zu: synistánaiÿ=
zusammenstellen; verknüpfen, zu: sınÿ= zusammen u. histánaiÿ= (hin)stellen,
aufstellen]:
- wissenschaftliches Schema, Lehrgebäude: ein philosophisches S.; Erkenntnisse
in ein S. bringen. - Prinzip, nach dem etw. gegliedert, geordnet wird: ein ausgeklügeltes S.; dahinter
steckt S. (dahinter verbirgt sich, wohl durchdacht, eine bestimmte Absicht); ein S.
haben; S. in etw. bringen (etw. nach einem Ordnungsprinzip einrichten, ablaufen
o.ÿÄ. lassen); nach einem S. vorgehen. - Form der staatlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Organisation;
Regierungsform, Regime: ein faschistisches, parlamentarisches S.; das bestehende
gesellschaftliche S. (die bestehende Gesellschaftsordnung). - (Naturw., bes. Physik, Biol.) Gesamtheit von Objekten, die sich in einem
ganzheitlichen Zusammenhang befinden u. durch die Wechselbeziehungen
untereinander gegenüber ihrer Umgebung abzugrenzen sind: [an]organische -e; ein
geschlossenes ökologisches S. - Einheit aus technischen Anlagen, Bauelementen, die eine gemeinsame Funktion
haben: technische -e; ein S. von Kanälen; ein S. (einheitliches Gefüge) von außen
liegenden Strebebögen und Pfeilern trägt das Dach. - a) (Sprachw.) Menge von Elementen, zwischen denen bestimmte Beziehungen
bestehen: semiotische, sprachliche -e; -e von Lauten und Zeichen;
b) in festgelegter Weise zusammengeordnete Linien o.ÿÄ. zur Eintragung u.
Festlegung von etw.: das geometrische S. der Koordinaten; ein S. von Notenlinien;
c) (bes. Logik) Menge von Zeichen, die nach bestimmten Regeln zu verwenden
sind: das S. der Notenschrift, des Alphabets. - a) (Biol.) nach dem Grad verwandtschaftlicher Zusammengehörigkeit gegliederte
Zusammenstellung von Tieren, Pflanzen;
b)
*periodisches S. (Chemie; Periodensystem).
Tra|di|ti|on , [Gelenek] die; -, -en [lat. traditio, zu: tradere, tradieren]:
a) etw., was im Hinblick auf Verhaltensweisen, Ideen, Kultur o.ÿÄ. in der Geschichte,
von Generation zu Generation [innerhalb einer bestimmten Gruppe] entwickelt u.
weitergegeben wurde [u. weiterhin Bestand hat]: eine alte, bäuerliche T.;
demokratische -en pflegen; eine T. bewahren, hochhalten, fortsetzen; an der T.
festhalten; die Strandrennen sind hier schon T. (feste Gewohnheit, Brauch)
geworden; mit der T. brechen;
b) (selten) das Tradieren: die T. dieser Werte ist unsere Pflicht.
Text|lin|gu|is|tik , [Metin Bilim] die: Zweig der Linguistik, der sich mit den über den
einzelnen Satz hinausgehenden Regularitäten, mit dem Aufbau u. Zusammenhang
von Texten u. mit Textsorten befasst.
vo|kal , [Ünlü] <Adj.> lat. vocalis = tönend, stimmreich, zu: vox, Vokal: von
einer od. mehreren Singstimmen ausgeführt; durch die Singstimme hervorgebracht,
für sie charakteristisch: -er Klang; -e Klangfülle.
Welt|sicht , [Dünya Görüşü] die: Sicht (2), Auffassung von der Welt.
Wis|sen|schaft , [Bilim] die; -, -en [(früh)nhd. für lat. scientia (zu scireÿ= wissen);
mhd. ·©’’¥®[´]schaftÿ= (Vor)wissen; Genehmigung]:
- (ein begründetes, geordnetes, für gesichert erachtetes) Wissen hervorbringende
forschende Tätigkeit in einem bestimmten Bereich: reine, angewandte W.; die
ärztliche, mathematische, politische W.; die W. der Medizin, von den Fischen; exakte
-en (Wissenschaften, deren Ergebnisse auf mathematischen Beweisen, genauen
Messungen beruhen, z.ÿB. Mathematik, Physik); die W. fördern; der W. dienen; die
Akademie der -en; alles atmet den Geist hoher W. (Wissenschaftlichkeit); sie ist in
der W. (im Bereich der Wissenschaft) tätig; Vertreter von Kunst und W. - jmds. Wissen in einer bestimmten Angelegenheit o.ÿÄ.: es dauerte, bis er mit
seiner W. herauskam.